Warum ich lieber ein Mann bin
Exemplarische Darstellung der textlichen Abwicklung eines bekräftigungsbezweckten Vorhabens
Von Bernhard Benz
Der Aufsatztitel ist ein aufsehenheischender Wurf – dies mag ich gar nicht erst, etwa mittels sogleich dagegengesetzter gesuchter Relativierungsrhetorik oder entbehrlicher Hinweise auf meine lautere Auffassung von seriöser Essayistik, vergeblich herunterzuspielen suchen – und eignet sich daher vermutlich vorzüglich, das lebhafteste Leseinteresse eines weitgestreuten Publikums zu wecken. Gockelhafte, eingefleischt Männlichkeitliche dürften sich beispielsweise versprechen, im vorliegenden Aufsatz die Tonart ihres Leiblobgesanges angestimmt zu finden und – zwar nicht dringlich nötig, aber immer wieder gern gelesen – ein engagiert-vehementes Bekenntnis zu den naturbedingten, zivilisationsgeschichtlich evident belegten, notwendigen Privilegien des Mannes gegenüber sämtlichen andern Kreaturen halt vielleicht auf Philosophenart etwas weitschweifig formuliert, aber insgesamt wohl recht brauchbar schwarz auf weiss ausgefertigt unterbreitet zu bekommen; Angehörige der verschiedenen Sorten landläufigen Durchschnittsmannsvolks, die doch heutzutage mehrheitlich arg gebeutelt aus der Bewältigung der Ansprüche in Familie, Haushalt und Freizeit und der Abwehr tückischer Benachteiligungen durch parteiische Justizorgane mit ihrer scheinheilig-selbstgerechten Inkriminierung jeglicher arglosen Manifestation von Entfaltung durchschnittsmännlicher Wesensart hervorzugehen drohen, mögen sich teilweise angelegentlich erhoffen, unter diesem Titel einige kräftige, genugtulich-restaurative Entlastungspostulate versammelt zu sehen und hilf- und erfolgreich argumentierte Behauptungsrezepte für die aufreibende Konfrontation in zugespitzteren Situationen mit Ehefrauen, Freundinnen, „Geliebten“ und zur Verteidigung des freien Mannessinns vor philogynen Richterfratzen angeboten zu erhalten; die stärkste Fraktion der Leseerpichten, die unüberschaubare, buntwogende Menge jenes verbreitetsten Typs von Frauen, die grobem, verallgemeinerndem männlichen Urteil zufolge so sind, wie sie nach Weiberweise halt so sind, liest einen solcherart betitelten Aufsatz mit bewundernswürdiger Aufmerksamkeit, emsig darauf bedacht, den Mann im Gatten, Freund, „Geliebten“ hoffentlich noch gründlicher zu verstehen, um ihn sich und den eigenen Absichten und Wünschen noch restloser gefügig zu machen; die vierte Gruppe, jene der eingeschworenen Feministinnen, mobilisiert womöglich gar das leidenschaftlichste Lektüreengagement hinsichtlich dieses Pamphlets, würde doch der darin aller Voraussicht nach sich berserkerhaft aufgipfelnde Machismo sich bestens dazu eignen, gleichsam als Wetzstein konträr fungierend, ihr Arsenal an tödlich geschärften geistigen und materiellen Waffen für den Kampf gegen Patriarchat und Phallokratie stattlich zu mehren. Zeloten und Fundamentalisten der diversen religiösen Bekenntnisse hingegen wittern Morgen- oder morgenländische Luft: Könnte da vielleicht einer aufgestanden sein, der, mit Engelszungen redend – und unbeirrt durch die blasphemistische Aufklärung und dekadente Strömungen und Trends der Moderne und Postmoderne –, mit Hilfe himmlischer Gnadengabe durch eine seherisch erleuchtete, unfehlbare Begründung und gelöbnisaktlich bekräftigte, aktuelle Erneuerung des Primats des Männlichen gleichnishaft-symbolmächtig heiliges Zeugnis ablegt für die mannsgöttliche Abkunft von Schöpfung, Sitten und Geboten und für die ur- und allväterlich liebend verheissene ewige Glückseligkeit in Abrahams bzw. Ibrahims Schoss? Ironiefreunde und -freundinnen sowie Humorgesegnete endlich, die aus allem und jedem das Element des (Selbst-)Parodieverdächtigen bzw. des unfreiwillig Komischen abzuzweigen imstande sind, mag der Titel dank ihrer sonderlichen Neigung und permanenten, hohen Lachbereitschaft beinahe wie ein gewissheitlich verbürgtes Versprechen groteskegewürzter Amüsierkost anmuten und locken oder irreführen. – Kreuz und quer durch die Gesellschaft herrscht also eine beachtlich gespannte Leseerwartung, der es nach Vermögen rechtschaffen zu entsprechen gilt.
Fasse ich nun nach diesen Präliminarien die Gestaltung des Hauptstücks ins Auge, fühle ich mich von einem machtvollen Verlangen heimgesucht, umgehend das Heraufsteigen inspirationsgesegneter beeindruckender, verblüffender, glänzender Initialgedanken oder Eröffnungsbilder und das Nachdrängen praller substantieller Gehaltträchtigkeit verspüren zu wollen. Da der gewünschte Effekt noch etwas im Verzug ist, befehle ich mir ein unverfänglich unprätentiöses Beginnen, welches sich befleissigt, im Gewande scheinbarer Konventionalität daherzukommen, und aber die Empfindsamsten unter der Leserschaft gleichzeitig wie ein heimliches Versprechen anmutet, dass die vorläufige Aufsparung von Originalitätssalven und -kaskaden eigentlich nur eine Komprimierung von deren weiter hinten umso fulminanter zu entfesselndem Detonationspotential bezweckt. – Es ist ein Gebot geradliniger, redlicher Argumentationsdisziplin, am gelingen sollenden Anfang nicht gleich mit einem prangenden Strauss kundig gepflückter Fragen wie „Warum?“, „Warum ich?‘“, „Warum lieber?“, „Gern oder lieber?“, „Lieber als?“ u. a. m. aufzuwarten, sondern knapp und sachlich zunächst allein aufs „Wer bin ich?“ einzutreten, um die da hirnend und schreibend tätige Person zu identifizieren, ihre Verfasserschaft zu legitimieren und damit freimütig, doch allürenfrei das im Scheitelpunkt der mannsperspektivischen Hinblicke die vor- und nachstehenden Aussagen und Unterlassungen vorbehaltlos verantwortende Subjekt anzuzeigen. Mein Name, kein Pseudonym, ist am Kopf oder Fuss des Textkörpers nachzulesen; er bezeichnet gemäss herkömmlicher Handhabung und Gepflogenheit ein biologisch maskulines menschliches Individuum, und Zweifel am diesbezüglichen Status wurden nie je weder von Passanten noch von näher Bekannten, noch von mir selbst gehegt oder angemeldet. Physiognomisch verkörpere ich nicht gerade einen Inbegriff kraftpaketiger, vitalitätsstrotzig-frohgemuter Naturburschenhaftigkeit; den psychischen Charakter einzuschätzen überlasse ich dem Leser und der Leserin, wenngleich ich mich anzumerken beeile, dass mein Aufsatz nicht darauf angelegt ist, meine Seelennatur lückenlos und umfassend zu widerspiegeln. (Im Übrigen lese man über den gigantischen Hinterbau der „Wer-bin-ich?“-Frage mit seinen bzw. ihren anthropologischen, ontologischen, phänomenologischen und weiteren erheblich gemachten Implikationen bei den einschlägigen und vorzugsweise respektabelsten Fachautoren nach, vor allem wenn dies als unserem Thema erhellend zudienlich erachtet werden will.)
Im assoziativen Umfeld einer mehr pragmatischen Ich-als-Mann-Erkundung regt sich nicht ganz unerwartet zuvorderst ein volksweisheitlicher Fingerzeig: „Man ist, was man isst.“ Ja, sollte denn wahrhaftig eine Steigerung oder Vereindeutigung des Männlichkeitsbewusstseins möglicherweise daraus resultieren, dass man bei Ernährungshandlungen, sei’s unwillkürlich oder mehr bezweckt, Speisen den Vorzug gibt, die von männlichen Tieren und von jenen Teilen von Pflanzen, die als männlich indiziert gelten, gewonnen werden bzw. ist tatsächlich Essbares auszumachen, nach dessen Einnahme sich eine Bestätigung, Konsolidierung und überzeugtere Selbstbilligung der naturgegeben vorliegenden (männlichen) Geschlechtsnatur nachweislich manifestiert? Und sollte etwa ein Mannseins-Bevorzugungsstolz noch eine merklich stärkere Ausprägung gar dadurch erfahren, dass man beim Lebensmittelverzehr neigungsgemäss oder mehr willensvorsätzlich auf eine markant überwiegende Einnahme von Produkten achtet, deren sprachlicher Bezeichnung ein maskuliner Artikel beigestellt ist? Abstrus! Entsetzlich ridikül! Närrisch! Doch die der Stoffwechselproblematik verpflichtete Ratgeberschaft gibt nicht vorschnell klein bei; man möge dann wenigstens die gehobene, weit über Darm, Leber, Lunge und Nieren hinausweisende Spruchvariante gebührend beachten und sorgfältig reflektieren: „Man ist, was man in sich hineinfrisst.“ Aussichtslos, bescheide ich, denn aufgrund der negativen konnotativen Sphäre des Insichhineinfressens gerät ein solcher Betrachtungszugang fundamental und von Anfang an in unüberwindbare Opposition zur bekennenden Bejahung, wie sie unser Titel ausdrückt! Und mit grimmem Lachen schicke ich der unsäglichen Binsenweisheitszumutung zusätzlich zwei vernichtende Abweisungsargumente hinterher: 1. Mein Ich hebt sich vom Allerweltsneutrum „Man“ aufs Kolossalste ab, ist in jenem Elementarsten, um das es hier geht, ohne Berührungspunkte mit diesem. 2. Gegen angeblich lebenserfahrungsklugheitliche Sprüche, die, wie es scheint, vielleicht ausschliesslich im Schosse der deutschen Sprachgemeinschaft aufdringlich und unverwüstlich rumoren, dazu noch allein um des matten Lichtes willen, das blosser dürftiger Reimwitz in spärlich erleuchteten Kreisen zu verbreiten imstande ist, regt sich in mir zuverlässig morosest-indignierte Ablehnung. „Du bist/er, sie, es ist, was du/er, sie, es isst“ – diese alternativ formulierten Versionen klebt ja alle noch jener suspekte Reimleim, aber „Ich bin, was ich esse“?! Und sollte dem u. U. nur vermeintlichen Volksgut gar die Formulierung „Der Mensch ist, was er isst“ zugrunde liegen, zu deren Rechtfertigung z. B. Feuerbach mehr philosophische, Paracelsus meinetwegen eher medizinische Gründe bemüht haben mag: Mich ficht dies hinsichtlich der Plausibilisierung des (Lieber-)Mann-Seins in keiner Weise an, denn diesbezüglich ist und bleibt der (wie immer drapierte) Spruch gänzlich irrelevant, basta!
Macht sich bei der Leserschaft vielleicht allmählich Ungeduld bemerkbar? Selbst des Verfassers bemächtigt sich ein unabweisbares Gefühl, dass auch der mussebegabtesten Interessierten massvoll-dezente Ansprüche kaum mehr weiteren Aufschub gewähren, im Sinne der Überschrift brauchbare, positiv erweisliche Argumentationen unterbreitet vorzufinden. Nichts oder Weniges ist mir daher nun dringlicher und prompter angelegen, als solche Empfindungen und Bedürfnisse stracks und angemessen zu befriedigen. Hierzu eignet sich der im Folgenden herangezogene und beschriebene, ebenso schlichte wie überzeugende Betrachtungsaspekt aufs Evidenteste, sodass die damit kaum erst an die Hand genommene Titelaussageuntermauerung dermassen bündig und auf alle Weise hinreichend erfolgt, dass sich mir im Hinblick auf die keinesfalls verkappt mitgeführte Allgemeingültigkeit, sondern vielmehr auf ein dezidiert persönliches Ich-Bekenntnis eigentlich die Erwägung eines Verzichts auf die Anreihung weiterer Begründungen nahelegte. Wenn mir jetzt nämlich mit der nötigen Gründlichkeit zu bedenken beliebt, dass auch noch unter den heute geltenden Bedingungen zwischengeschlechtlichen Verhaltens die Frau zuallermeist über Gebühr hohe physisch-ästhetische Ausweise vorzuzeigen haben muss, um beim Manne eine Anerkennung zu finden, die sich hinwiederum dann jedoch grösstenteils nur auf diese sinnliche Qualität bezieht, dann habe ich denkbar wenig Grund noch Lust, die Frau sein zu wollen, die zu sein mir auferlegt wäre, wenn ich aller Wahrscheinlichkeit nach meine aktuelle Position im letzten Drittel einer fiktiven physiognomischen Mannsbilds-Attraktivitätsrangliste in den entsprechend kümmerlichen Stellenwert dieser hypothetischen Weiblichkeitsverkörperung transformiert bekäme! Nein, da bleibe ich lieber Mann mit sogenannten inneren Vorzügen! (Ausserdem: Die tief in meinem Wesenskern wurzelnde ausschliessliche Affizierbarkeit durch weibliche Anmutung und Reize beraubt mich in erotischer Hinsicht des für gewöhnlich respektablen Antizipationsvermögens; die Vorstellung, aufgrund gesetztenfalls ins akkurate Gegenstück umgepolt transformierter Heterosexualität und wegen in welchem Grade auch immer begehrenswert konfigurierter bzw. hingebungsvoll beseelter Weiblichkeit im Verwandlungszustand von Männern mit sexuellem Begehren bedrängt zu werden, bereitet mir angesichts in dieser Beziehung unübersteigbarer Grenzen des affirmativen Vorwegnehmens, gelinde gesagt, beträchtliche Unbehaglichkeitsaffekte.)
Und sogleich bietet sich ein zweites, stattliches Argument an, das Mannsein und -bleiben gewissheitlich zu favorisieren: Ich sehe die erwiesenste Notwendigkeit ein und verfechte mit zu Gebote stehendem Engagement die endlich nicht rasch genug erfolgen könnende Überführung aller patriarchal geprägten Sozial-, Wirtschafts- und Machtstrukturen in matriarchal geregelte und geleitete, von herzlich-weicher Weiblichkeit durchdrungene Organisationsformen und Institutionsgewirke. Wenn nämlich die durch die ruhm- und ehregeblähten, waffenerigierten Hähne, ratiogeplusterten, machtberauschten, gewalt- und ausbeutungsversessenen Gockel ruinierte Erde, globale Gesellschaft und Menschenexistenz an der apokalyptischen Katastrophe noch knapp vorbeigesteuert und in harmonisch-idyllische Natur- und Gemeinschaftswirklichkeiten überführt werden will, dann lässt sich ein solcher Umschwung zum Gedeihlichen nur realisieren, wenn kompromiss- und verzugslos der Durchsetzung eines weltweit verbindlich und zwingend gebotenen und befolgten Primärgrundsatzes, wonach die Frau denkt und das Weib lenkt, der Weg geebnet wird. Weil nun aber zwecks Bewerkstelligung dieses fundamentalen weltgeschickbestimmenden Wandels das Potential der von aussen dafür Kämpfenden, also die Zahl der seitens der realen gegenwärtigen Frauengesamtheit denk- und lenkwilligen und -fähigen Individuen, unermesslich hoch veranschlagt werden darf, hingegen im Lager des abzutakelnden Männlichkeitlichen die Reihen der subversiv und partisanenartig von innen den Umsturz Anstrebenden, also der Männer von meinem Schlage, eher dünn besetzt sind, lässt sich im sachlagerelevanten Erfolgsinteresse auch von dieser Betrachtungswarte aus beurteilt niemals guten Gewissens wünschen, lieber eine Frau zu sein!
Der ganzen hieran teilhabenden Rezipientenschaft, von der genusslustig vorurteilsfreien Allesleserin bis zum reserviert-skeptischen oder notorisch krittelsüchtigen Fachleser, teilt sich wohl wenigstens mehrheitlich einhellig der Eindruck mit, dass ich mich sichtlich mit Eifer mühe, aus diesem Aufsatz alles selbstzweckhafte Fabulieren und exaltierte Phantasieren fortzulassen und im Dienste der Titelthesenerhärtung eine schnörkellose, nüchtern erfolgsorientierte Beweisführungsstrategie zu verfolgen. So mag es denn niemanden und schon gar nicht bass erstaunen, dass ich – nach einem ersten ästhetisch-erotischen und dem zweiten sozialhygienischen – mit der Unterbreitung eines dritten, psychologisch-existenziellen Arguments aufwarte und damit die unwiderstehliche Stringenz meiner Mannseinsbevorzugungsrechtfertigung komplettiere und gleichsam kröne. Und zwar so: Indem ich tatsächlich ein Mann bin – weniger zwar hinsichtlich einer klischeehaft prototypspezifischen Mentalitätsbeschaffenheit als eher gemäss naturverfügt gegebenen anatomischen Merkmalen –, und insofern dieses Mannseinsschicksal im diesbezüglich von mir geltend gemachten, demütig anerkannten Normalfall ein lebenslang beschlossenes Faktum darstellt, ferner soweit eine Existenz ohne das Hereinbrechen von katastrophalen Notlageumständen und unter insgesamt unproblematisierter Vorwaltung unwillkürlicher, leidlich-genügsamer Affirmation bis zu deren Ende auszudauern ist und dies, wenn schon, dann unter Bedingungen von unprätentiöser Akzeptation und intaktem Entfaltungs- und Behauptungswillen geschehen soll, und endlich sofern einem der Status des nicht von ätzenden Selbstzweifeln und wuchernden Entsagungsneurosen Gequälten von Herzen gegönnt sein darf, halte ich es für rätlich und weislich für unumstösslich, lieber Mann zu sein und zu bleiben!
Ich glaube, beim so weit gediehenen Stand der Dinge zu konstatieren befugt zu sein, dass die von mir intendierte Beweisführung gediegen geglückt ist, der Ausräumung allfälliger diffuser wie mehr spontan-unreflektiert vorurteilbehafteter Zweifel gedient hat, jene Leserinnen und Leser, die sich mit voreingeräumtem Wohlwollen auf den Verfasser eingelassen haben, angemessen belohnt und Heitersinn stiftend befriedigt, die andern aber mit sich und ihrer vielleicht sporadischeren, vielleicht habitualisierteren Streitbarkeitsneigung sowie auch mit mir irgendwie, zumindest teilweise, versöhnt hinterlässt und daher als erfolgreich abgeschlossen erklärt werden darf.
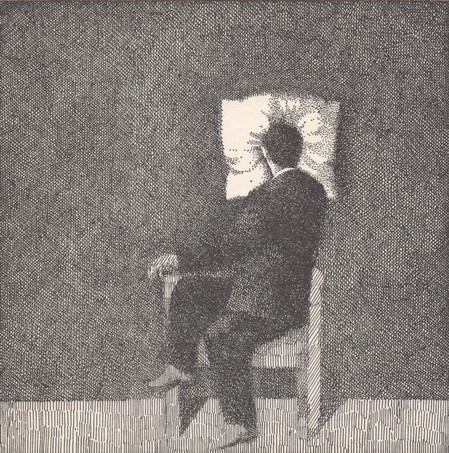
Zeichnung Gottfried Wiegand:
Zu dicht vor einem Gegenstand sitzen
Meinetwegen mag man es als Allüre demonstrativer Gelassenheit, die zudem mehr auf schnöden Indifferentismus als auf charakterliche Noblesse zurückzuführen wäre, auffassen oder mir eine angestrengt erzirkelte Attitüde herablassungsverdächtiger scheinbarer Grossherzigkeit vorwerfen, wenn ich an dieser debattentaktisch vorteilhaften Stelle einen Meinungswidersacher zu Wort kommen lasse, um ihn ein seiner, wie es scheint, etwas exzentrischen Überzeugung nach beeindruckend bildstarkes Gegenargument darlegen zu lassen. Dabei verrät dieser (episch durchaus talentierte) Einsprecher allerdings keine noch wenigstens massvollste Genierung, sich zugunsten seines Widerlegungsversuchs einer philiströs-emotionalistischen Zitatstrapazierung zu bedienen. – Ich müsse mir – trotz, wenn nicht gerade wegen z. T. üppig abgesonderter, aber doch wohl stark flatteriemotivierter feminismusfreundlicher Verbalergüsse – nur schonungslos redlich eingestehen, mich vom insgesamt fraglos monolithisch geeinten Gros der heterosexuellen Herrencliquen bezüglich der archetypisch naturverfügten Einschätzung der Weiber als Lustgenuss bereitende und Erholung spendende Spiel- und Ergötzungsobjekte im Grunde nicht ausnehmen zu dürfen. Zudem erheische eine überfällige, strikte Beobachtung bedingungsloser Wahrhaftigkeit auch das Preisgeben der bei mir so gut wie gewissen, aber verschämt gehüteten Heimlichkeit, vermutlich saftrumorig angetrieben und wahrscheinlich leitsatzartig verinnerlicht – zumal als augenfällig effekt- und eindrucksbemühter Halbgebildeter – dem zwiespältig beleumdeten „zarathustrischen“ (Altweiber-)Rat „Du gehst zu Frauen? Vergiss die Peitsche nicht!“ allzeit gelegenheitsgewärtig zu huldigen. – Jetzt aber müsse ich mir ohne Umschweife anschaulich und realitätsnah genug vorstellen, als der also wahren Neigung gemäss gearteter Herr just und mit einiger angesammelter Vorfreude ausgestattet zu einer Entzücken versprechenden Dame unterwegs zu sein, leider beispielsweise und zufällig bei drückend schwülst über der Stadt lastender Hochsommerhitze. Weiter sei ich ersucht anzunehmen, ich befände mich gerade, bekleidet mit enggeschnittener weisser Leinenhose und hellblauem Seidenhemd, von fortgesetzt neu Zusteigenden an einen exponierten, von allen Seiten gut einsehbaren Stehplatz gedrängt, im glutofenheissen Tram, unter Empfindungen hoher Penibilität die mitgeführte Peitsche, für die ich infolge erwartungsfroh-eiligen Aufbruchs ein Futteral oder sonstiges, geeignetes Behältnis beizubringen versäumt habe, mehr schlecht als recht von der Achselhöhle an abwärts unter dem so zwanglos wie möglich und gleichwohl verkrampft an den Körper gepressten Arm verbergend, von rapid zunehmendem Herausperlen, beinahe schon -schiessen und -strömen von Schweisstropfen und -rinnsalen aus allen Poren in unbeschreibliche Inkommodität getrieben, das Hemd bald an Rücken und Brust und von der unteren Oberarmpartie bis zum Hosenbund beidseits auf der Haut klebend und die Qualumstände in Form von dunkelblau-klitschklatschnassen Riesenklecksen für jedermann weithin sichtbar prangerartig entblössend, die Haare im Nacken und an Stirn und Schläfen strähnig angeklatscht, überströmten Gesichts, schamzermartert, geruchsausdünstend, in höllengrundtiefe Würdelosigkeit zerflossen, aber trotz inständig bzw. -brünstig erflehter Besinnungslosigkeit panisch wach und gleichzeitig paralysiert des heillosen Endes harrend … – ob mir jetzt und angesichts solcher untergangsträchtiger Umstände, deren frappierende Drastik er, der Argumentationsgegner, um der Einsichtsbeschleunigung willen gewählt habe, nicht wenigstens zunächst in vagen Umrissen erahnbar, aber sehr bald doch allein nur noch Rettung verheissend, der vehemente Wunsch heraufdämmere, wiederum beispielsweise doch lieber eine Frau zu sein, zumal – wie ich dann etwas später bei einiger Gefasstheit bedenken könnte – Damen, zu denen Herren unterwegs sind, bequem bei sich zu Hause weilen können und zudem heutzutage oft auch schon selbst über eine Versandhauspeitsche verfügten, deren auf den billigen gerippten oder genoppten, pinkfarbenen Kunststoffschaft zurückzuführendes leicht vulgäres Odium als verhältnismässig nebenrangiger Detaileffekt in Kauf genommen werden könnte! – Na ja …; mich jedenfalls kann dieser doch reichlich gekünstelt erklitterte Umstimmungsversuch niemals zu einem Gesinnungswandel locken. Mögen Leserin und Leser den Anstrengungsaufwand des Kontrahenten wohlerwogen und angemessen würdigen, ich hingegen beschliesse, den nach meinem Urteil fruchtlosen Fleiss mit einem freundlichen Lächeln, dem jede zum Sibyllinischen, Mokanten, Mitleidigen oder Skurrilitätsverständnisinnigen tendierende Nuancierung fehlen soll, zu quittieren, will aber doch – offenbar von mich selbst leicht befremdender Pedanterie gestreift – fussnotenartig anmerken, dass mich Fr. Nietzsches wortgewaltige Sprachmächtigkeit allgemein zwar mit entsprechender und freimütig geäusserter Bewunderung erfüllt, nicht aber sein destruktiv-widersprüchliches, egomanes Philosophieren im Ganzen und dass ich in Bezug auf die psychoanalytische Einschätzung seiner Persönlichkeit die Befunde und Ansichten Lou Andreas-Salomés einhellig teile.
Endlich in hohem Masse überfällig dünkt wohl nunmehr der hieran beteiligten Leser- wie Schreiberschaft, dass spätestens an dieser Stelle ein Text- bzw. Explikationsstadium angezeigt werde, das keinen noch so kurzen Exkurs mehr gerechtfertigt erscheinen lässt, vielmehr ein schleuniges, wo nötig Wogen glättendes, mildes Ausmünden in hoffentlich denkbar knapper, schlanker Schlussfigur nahelegt. Solcher dankbar konstatierter Einsicht stracks folgend, gilt es hauptsächlich geziemend kleinlaut einzugestehen, die so gut wie verzugslos anschliessend präsentierte Abrundungsphrase eigentlich vom Beginn her antizipiert und ihr den Aufsatztitel entliehen zu haben. Und wie der Anfang von kläglich fehlschlagender Schweifigkeit, so das Ende von vielleicht da und dort ernüchternd karg empfundener Lapidarität, die etwas krakeelige Überschrift wie folgt in den vorwegentworfen-angestammten, den Geist von Zurückhaltung und Genügsamkeit atmenden Kontext zurückbettend:
Unter gegebenen Umständen wäre ich allenfalls gern eine Frau;
lieber bin ich ein Mann – da ich’s, billig-willig, bin;
am liebsten wäre ich …
Wer, wie, was? – Nun, das ist nicht mein Thema! Aber ich füge immerhin bei – allerdings im Sinne unvorgreiflicher Beiläufigkeit –, dass mir keine philologische Autorität bekannt ist, die einen „obligaten Superlativ“ postuliert. Anderseits besinne ich mich – ohne eigens darob viel Wesens zu machen – doch reichlich spät noch des möglichen Umstandes, dass ich Autonomiebewussteste und kreativ Begabteste unter der Leserschaft durch die Aufbietung einigen sophistischen Bombastes aufsatzlang an der allfälligen Entfaltung gewünschter und gewohnter eigener, ihren Lesegenuss und Reflexionsgewinn steigernder Phantasie- und Assoziationstätigkeit wahrscheinlich nicht unbeträchtlich gehindert habe. Die diesbezüglich Betroffenen seien daher und hiermit eingeladen, je nach persönlichem Bedürfen und Vermögen an der offengelassenen Vergleichshöchststufe fortspinnend, -webend, -strickend sich kreationswillensbezogen halbwegs schadlos zu halten und darüber hinaus dank meines mit dem Schluss dieses Satzes (im Zusammenhang mit dem angeschnittenen Thema bzw. seiner klärungsbezweckten Erörterung) unwiderruflich besiegelten Verstummens voller damit freigesetzten drangvollen Elans in gedanklichen Funkenwürfen, Bilderbögen und Flechtgewirken beliebigsten Ausgangs, Sinns und Ziels sich aufs Üppigste auszutoben.
